Der folgende Artikel wurde von Lesley Evans Ogden für Mosaic verfasst. Mosaic ist ein neues Onlinemagazin, welches vom Wellcome Trust betrieben und finanziert wird. Der Wellcome Trust ist eine gemeinnützige Treuhand mit Sitz in London, die 1936 gegründet wurde. Das Ziel ist “Forschung zu fördern, um die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern.” Der Trust ist mit einem Stiftungsvermögen von 14,5 Mrd. Pfund, nach der Bill and Melinda Gates Foundation, die weltweit zweitreichste Stiftung, die medizinische Forschung fördert.
Ich danke Mosaic und dem Wellcome Trust für die Genehmigung, eine Übersetzung des Artikels an dieser Stelle zu veröffentlichen. Dieser Artikel steht unter Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International-Lizenz.
Es war ein Morgen wie jeder andere. Bis ein Busfahrer eine rote Ampel missachtete, rechts abbog und dabei Ann-Doerthe Hass Jensen übersah. Der Bus holte die Sozialarbeiterin von ihrem Fahrrad, überrollte sie mit einem Reifen und zerschmetterte dabei ihren linken Fuß. Es war ein Schulbus, welcher in Richtung Kopenhagen fuhr, und die Kinder an Bord schrien aus verständlichen Gründen. Ann wurde unter entsetzlichen Schmerzen ins nächste Krankenhaus gebracht, jeder Knochen in ihrem Fuß war gebrochen.
Während der sechs Wochen, die sie im Krankenhaus lag, mussten Teile ihres Fußes amputiert werden. Die rettbaren Knochen wurden so gut es eben ging wieder in Form gebracht und Hauttransplantate von ihrem Oberschenkel entnommen, um das zerfetzte und fehlende Fleisch zu ersetzen. “Ich hatte sehr viel Glück”, sagt Ann. “Sehr oft überleben Menschen solche Unfälle nicht.”
Es dauerte ein Jahr, bis sie wieder laufen konnte. Während dieses Jahres musste sie jeden Tag mit dem Taxi zur Arbeit fahren. “Ich hasste es”, sagte sie. “Die Taxifahrer fahren wie die gesengte Sau und ich hatte wirklich Angst vor einem Unfall.” Sie hasste es ebenfalls, dauernd warten zu müssen. Eine Fahrt mit dem Fahrrad ist in Kopenhagen oft die schnellste Möglichkeit, um an das Ziel zu gelangen. Der Grund, wieso das Fahrrad bei Kopenhagenern so beliebt ist.
Anns Physiotherapie war schwierig. Der fehlende Teil ihres Fußes ist für das Gehen sehr wichtig und sein Fehlen beeinträchtigt ihre Balance. Das wieder Laufen lernen war jedoch nicht der einzige Teil ihrer Wiederherstellung. In Kopenhagen – wo auf jedes Auto 5,2 Fahrräder kommen – fahren über ein Drittel der Einwohner mit dem Fahrrad zur Arbeit, Schule oder in die Universität. Ein Teil des Rehabilitationsprozesses bedeutet also sehr oft, wortwörtlich wieder in den Sattel zu steigen. Die Stadt Kopenhagen half Ann, ein spezielles Fahrrad von nihola zu bekommen: ein stabiles Dreirad, welches ihr erlaubt wieder unabhängig und mobil zu sein.
In vielen Städten auf der ganzen Welt heben Wissenschaftler, Planer und Politiker die vielen positiven Seiten des Radverkehrs hervor. Durch eine wachsende Zahl von Menschen, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, anstatt das Auto zu benutzen, verringert sich nicht nur die Luftverschmutzung und die Emission klimaschädlicher Treibhausgase, sondern auch das Risiko an bestimmten Krankheiten zu erkranken. Aber zu welchem Preis? Welchem Verletzungs- oder gar Todesrisiko setzt man sich in Städten aus, wenn man mit dem Fahrrad fährt? Und was macht manche Städte für Radfahrer so viel sicherer und attraktiver als andere?
Die sehr unterschiedlichen Ansätze in europäischen und nordamerikanischen Großstädten hinsichtlich der Gestaltung und der politischen Unterstützung des Radverkehrs lassen einige krasse Vergleiche hinsichtlich Sicherheit, Gerechtigkeit und der Wirkung auf die öffentliche Gesundheit zu. Um den Nutzen und die Risiken des städtischen Radverkehrs miteinander zu vergleichen und herauszufinden, was passiert, wenn öffentliche Gesundheit, Städtebau und Verkehrsingenieurwesen aufeinandertreffen, machte ich, was ich machen musste: Ich stieg aufs Rad.
§
In Paris sind neue Radwege allgegenwärtig. Obwohl manche Straßen Jahrhunderte alt, manchmal gepflastert und klaustrophobisch eng sind, wurden gut erkennbare Radfahrstreifen abmarkiert. Ebenfalls gibt es einige separate Radwege, oftmals verrückt angeordnet – sie verschwinden und tauchen in wilder Reihenfolge neben der Straße auf. Enge Einbahnstraßen haben den Radfahrstreifen entweder auf der rechten Seite, sodass man mit dem Verkehrsfluss fahren kann oder auf der linken Seite, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung.
Komischerweise fühlte ich mich keineswegs unsicher, in diesen engen Gassen mit dem Fahrrad zu fahren. Viele haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Dass Fahrzeuge rechts vom Radweg und aus Sicht des Radfahrers in entgegengesetzte Richtung parken, hat ebenfalls einige Vorteile. So sieht der Beifahrer den Radfahrer auf sich zukommen, bevor er die Tür öffnet. Außerdem kommt es seltener vor, dass die Beifahrertür überhaupt geöffnet wird. Und wenn ein Fahrradfahrer wirklich einmal in eine offene bzw. sich öffnende Tür fährt, so gibt diese nach, und schließt sich, statt sich weiter zu öffnen und ein starres Hindernis darzustellen.

Auf einigen Hauptstraßen, wie beispielsweise dem Boulevard Saint-Michel, gibt es gemeinsame Fahrspuren für Busse und Radfahrer. Obwohl ich mehr Platz hatte und mich wegen des geringeren Verkehrsaufkommens weniger bedrängt fühlte, war ich dennoch etwas eingeschüchtert, meine Spur mit einem Bus zu teilen. Erstaunlicherweise gaben die Pariser Busfahrer mir jedoch ausreichend Platz und verhielten sich keineswegs aggressiv. Ich bekam das Gefühl, dass der Verkehr sich an das Fahrrad gewöhnt zu haben schien.
Einige Radwege sind zudem komplett von der Straße getrennt. Mit dem Fahrrad, vollständig vom übrigen Verkehr getrennt, die Seine entlang zu sausen, war ein reines Vergnügen.
Vélib’-Räder des gleichnamigen Pariser Bikesharing-Systems wurden überall und von jedem genutzt. Ich sah Männer in Anzügen, Teenager, Frauen in Kostümen, Rentner und Studentinnen, die in Eintracht nebeneinander mit diesen Rädern fuhren. Das Posten von Fotos, die Stars und Sternchen auf Vélib’-Rädern zeigen, hat sich zu einer Art lokaler Freizeitbeschäftigung entwickelt. Ich sah sogar einen jungen Mann, der eine Pause auf einem geparkten Vélib’ einlegte und in entspannter Haltung mit den Füßen auf dem Lenker telefonierte.

Inmitten der Pariser Fahrradrevolution erschien es mir angemessen Ari Rabl im Restaurant Le Procope, ein Ort, an dem sich einige Führer der französischen Revolution gerne aufhielten, zu treffen. Gemeinsam mit Audrey de Nazelle vom Centre for Environmental Policy am Imperial College London hat Rabl, ein Berater und pensionierter Wissenschaftler am Centre Energétique et Procédés der École des Mines in Paris, die positiven Gesundheitseffekte des Radverkehrs untersucht.
Rabl erklärte mir, dass die volkswirtschaftlichen Schäden, welche durch tödliche Unfälle entstehen, durch die positiven Effekte des Fuß- und Radverkehrs mindestens zehn Mal kompensiert werden. Rabl und de Nazelle schätzen, dass der Gesundheitseffekt für einen Autofahrer, der seinen 5 km langen Arbeitsweg mit dem Fahrrad statt mit dem Pkw zurücklegt, etwa 1.300 Euro jährlich entspricht. Natürlich ist es wichtig festzuhalten, dass tödliche Verkehrsunfälle, auch wenn sie mit geringen „Unfallkosten“ für die Gesellschaft assoziiert werden, natürlich tragische und katastrophale „Kosten“ für den Betroffenen selbst und die Angehörigen mit sich bringen.
§
Vier Tage zuvor, und einige Tausende Kilometer nordöstlich, saß ich in einem Besprechungsraum des Department of Public Health der Universität Kopenhagen mit Aussicht auf die malerische Seenlandschaft. Mit mir am Konferenztisch saßen die Wissenschaftler Astrid Ledgaard Holm, Henning Langberg und Henrik Brønnum-Hansen.
Ledgaard Holm, eine Doktorandin, hat die Gesundheitseffekte des wachsenden Radverkehrs modelliert. 1 Auf der einen Seite erfahren Radfahrer die körperliche Aktivität, auf der anderen Seite sind sie jedoch Unfällen und Luftverschmutzung ausgesetzt. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Gesamtbelastung durch Krankheiten – inklusive Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Typ II-Diabetes, Brustkrebs, Darmkrebs, kardiopulmonale Erkrankungen und Lungenkrebs – bei regelmäßig fahrradfahrenden Personen deutlich reduziert war. Die positiven Gesundheitseffekte des Radverkehrs waren über ein Drittel größer als die potenziellen Gefahren durch Unfälle und Luftverschmutzung.
Andere Studien, welche die Gesundheitseffekte des Radverkehrs untersucht haben, kamen zu ähnlich positiven Ergebnissen, wenn auch die Bandbreite variiert. In einer weiteren Studie 2 aus Kopenhagen wurden Daten von über 13.000 Frauen und 17.000 Männern ausgewertet, um die Wirkung von körperlicher Aktivität auf die Sterblichkeit zu untersuchen. Auch nach Anpassung einiger Faktoren, wie beispielsweise zusätzliche sportliche Betätigung in der Freizeit, stellten sie fest, dass Menschen, die nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhren, eine 39 Prozent höhere Sterblichkeit aufwiesen als jene, welche das Rad für den Weg von und zur Arbeit nutzten. Mit anderen Worten: Fahrrad fahren verlängert die Lebensdauer.
Eine der interessantesten Erkenntnisse der dänischen Wissenschaftler ist zudem, dass die meisten Dänen das Fahrrad fahren nicht als Sport betrachten. „Hier lebende Menschen können leicht 5 Kilometer jeden Tag von und zur Arbeit fahren und, wenn man Ihnen in einer Befragung die Frage stellt, ob sie körperlich aktiv sind, werden sie antworten „Nein, ich mache keinerlei Sport.““, so Ledgaard Holm. Für viele hier ist die Wahl des Fahrrads keine Frage der körperlichen Betätigung, sondern nach dem für sie passenden Verkehrsmodus.
Was einem am Kopenhagener Radverkehr sofort auffällt, ist die unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Typen von Radfahrern. Eines Morgens habe ich mich während der Hauptverkehrszeit an die Nørrebrogade, einer der am stärksten befahrenen Radwege Kopenhagens, gestellt, und eine Frau in einem wehenden schwarzen Jilbab auf einem Cargobike mit zwei kleinen Kindern im Korb beobachtet. Ich sah Männer jeden Alters in Anzügen, Frauen in hochhackigen Schuhen, Regen abweisenden Mänteln und flatternden Kleidern, welche durch einen Speichenschutz vor Beschädigung geschützt werden.

Es waren zudem viele Studenten und Kinder auf dem Weg zur Schule unterwegs; Kleinkinder in speziellen Kindersitzen, die vorne oder hinten auf Mama oder Papas Fahrrad montiert waren; und Kinder in speziellen Körben, welche an robuste Christiana- oder stromlinienförmige Bullit-Räder befestigt werden. Einige Kinder sind bereits ganz alleine unterwegs. Andere Kinder wiederum werden von ihren Eltern begleitet, die diese mit einer Hand auf dem Rücken sanft durch das Getümmel führen.
Während ich eines Morgens zu Interviews an die Universität Kopenhagen geradelt bin, stieß ich zufällig auf eine improvisierte Gedenkstätte am Straßenrand. An der Kreuzung von Store Kongensgade und Dronningens Tværgade im Stadtzentrum war ein Teil der Fahrbahn, etwa auf die Länge eines menschlichen Körpers, mit frischen Blumen geschmückt, in denen Einmachgläser mit Kerzen und handgeschriebenen Notizen steckten. Ich fand später heraus, dass es eine 20-jährige Frau gewesen war, die einige Wochen zuvor auf ihrem Fahrrad von einem rechts abbiegenden Touristenbus angefahren und getötet worden war.
Auch Jahrzehnte, nachdem die Straßen zunächst mit weißen Kreuzen bemalt wurden, um getöteten Radfahrern zu gedenken, werden Unfälle mit Radfahrern, obwohl sehr selten, nicht auf die leichte Schulter genommen. Im Jahr 2012 kam in Kopenhagen nur ein einziger Radfahrer ums Leben und in keinem Jahr zwischen 1998 und 2012 gab es laut Statistikamt mehr als sieben getötete Radfahrer in der Stadt. Diese Zahlen sind sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Stadt handelt, in der die Bevölkerung schätzungsweise jeden Tag 1,27 Millionen Kilometer mit dem Rad zurücklegt. Das Risiko für Radfahrer „ist in den vergangenen 15 Jahren um mehr als 70 Prozent zurückgegangen.“, so Niels Torslov, Chef der Kopenhagener Verkehrsplanungsbehörde. „Und es war eine sehr schwierige Angelegenheit, die richtigen Maßnahmen zu finden und den Straßenraum so zu gestalten, dass die Verkehrsteilnehmer, und insbesondere die Radfahrer, geschützt sind.“
Immer mehr Kopenhagener tragen einen Fahrradhelm. Weitaus mehr als in Amsterdam, wo das Tragen eines Radhelms immer noch eine große Ausnahme ist. Auch Ann-Doerthe Hass Jensen trug bei ihrem Unfall im Jahr 2006 einen Helm, auch wenn dieser, wie sie auch selber sagt, natürlich den Kopf und nicht die Füße schützt. Sie ist überzeugt, dass ihre Arbeit am Kopenhagener Zentrum zur Rehabilitation von Hirnverletzungen sie zu einer Helmfanatikerin gemacht hat. „Es gibt keine Situation, in der ich keinen Helm tragen würde.“
Nachdem ich Kopenhagen einige Tage mit dem Fahrrad erkundet habe, treffe ich Ann bei ihrer Arbeit, wo sie mir ihr speziell umgebautes Dreirad zeigt. Ihr Stolz ist fühlbar. Sie braucht etwa 30 bis 40 Minuten von ihrer Wohnung zur Arbeit. „Die ersten Male, als ich wieder aufs Rad steig, waren hart. Wirklich, wirklich hart“, sagt sie. „Ich habe sehr viel geweint.“ Heute allerdings kann sie nichts mehr bremsen.
Im ersten Jahr ihrer Reha hatte ihr Betreuungsteam das Gefühl, dass sie sowohl den Grad an Mobilität wie auch die Lebensqualität, die ihr das Fahrrad zuvor ermöglicht hatte, wieder brauchte. Es war nicht einfach. Neben der körperlichen Herausforderung, Ann wieder auf den Sattel zu setzen, gab es eine weitere Hürde: ihre enorme Furcht. „Ich musste mit einem Psychologen daran arbeiten…weil ich höllische Angst hatte.“ Im Rahmen einer kognitiven Therapie arbeiteten sie und ihr Psychologe die Erlebnisse auf. Inklusive des Unfallberichts bis ins kleinste Detail. Mit der Angst klarzukommen war sehr hart. „Meine Sinne waren an diesem Tag nicht ausgeschaltet. Es war jemand anderes, der einen Fehler gemacht hat. Mich hat es eine Weile gekostet, bis ich mein Selbstvertrauen wieder fand.“ Anns Angst ist nicht unbegründet. Sie hat nicht „nur einen Unfall“ erlebt. Es war vielmehr die Tat eines unachtsamen Fahrers, dessen Fahrerlaubnis eingezogen wurde, als der Fall zwei Jahre später vor Gericht verhandelt wurde.
§
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das gefühlte Sicherheitsempfinden mindestens genauso wichtig ist wie die real messbare Sicherheit. Von den sieben Städten, in denen ich mit dem Fahrrad unterwegs war, fühlte ich mich in London mit Abstand am unsichersten.
Im Stadtzentrum waren Fahrradfahrer weit verbreitet und was mir neben des sehr schnell fahrenden Verkehrs sofort ins Auge stach, war die enorme Geschwindigkeit, mit der die Radfahrer selber unterwegs waren. In einem spontanen Interview mit Radfahrern, welche an roten Ampeln hielten, fragte ich eine Frau, wieso sie mit dem Fahrrad fahre. Ihre Antwort: „Ich hasse die Tube [Londons U-Bahn]. Es ist ungesund, heiß und überfüllt.“ Auf die Frage, ob sie sich auf dem Fahrrad sicher fühle, antwortete sie: „Nein. Und das ist eine ehrliche Antwort.“ Ihre Meinung wurde jedoch nicht von jedem geteilt. Eine Studentin, die kurz zuvor erst nach London gezogen war, antwortete mir auf meine Frage: „London ist fünf bis zehn Jahre vor New York.“, und fügte hinzu, dass sie sich auf den Londoner Radschnellwegen recht sicher fühle.
Ich, andererseits, tat das nicht. Ich habe einige Zeit damit verbracht, Fahrradfahrern bei der Fahrt auf dem Radschnellweg über die Southwark Bridge zuzusehen. Eine Fahrt auf dem Radschnellweg CS7 mit einem Boris Bike (der Spitzname für Londons Fahrradverleihsystem, welches 2010 unter dem Londoner Bürgermeister Boris Johnson eingeführt wurde), ein Radweg, der auf einer Hauptverkehrsstraße mit viel und sehr schnell fahrendem Verkehr blau abmarkiert ist, verängstigte mich. Zudem leide ich an Asthma, sodass ich mir ein bisschen wie ein menschlicher Kanarienvogel für Luftverschmutzung vorkam. [Anmerkung Martin Randelhoff: Früher hat man Kanarienvögel mit in Kohleminen genommen, um durch das Ausbleiben ihres Gesangs vor dem Erstickungstod gewarnt zu werden.] Nach der spürbar sauberen Luft in Kopenhagen, fiel mir in London das Atmen sehr schwer.

London hat jedoch in jüngerer Vergangenheit mit zahlreichen Maßnahmen für den Radverkehr bereits einige Fortschritte gemacht. Es gibt durchaus auch einige Abschnitte mit einer wirklich guten Radverkehrsinfrastruktur, aber ich habe dennoch viel Raum für Verbesserungen entdeckt. Auf beiden Seiten der Southwark Bridge, welche die Themse überspannt, führte der kurze, separierte und blau markierte Radweg, welcher zudem durch eine Betonbarriere vom restlichen Verkehr getrennt ist, direkt in eine Bushaltestelle. Dies zwingt Radfahrer dazu, zwischen zwei unangenehmen Optionen zu wählen: Entweder sie warten hinter dem haltenden Bus oder sie überholen denselben und riskieren in einen seiner vielen toten Winkel zu geraten, wenn er aus der Busbucht herausfährt.
Peter Wright ist der Planer für Radverkehr bei Transport for London (TfL), der Londoner Verkehrsbehörde. Wright erklärt mir, dass Beipässe an Haltestellen geplant sind, “um Konflikte zu vermeiden und zu verhindern, dass Radfahrer in den fließenden Verkehr fahren müssen.” Ein sehr ähnlicher Gefahrenherd sind Lieferwagen, die auf Radfahrstreifen parken. Ein sehr häufiges Bild in London und Paris.
Im November 2013 antwortete der Londoner Bürgermeister Boris Johnson dem Guardian auf die Frage nach der Welle von getöteten Radfahrern, dass „er kein einziges Pfund in Radverkehrsanlagen investieren wird, die Menschenleben retten“, solange sich die Fahrradfahrer nicht an die Verkehrsregeln halten. Es gibt jedoch zunehmend Beweise, dass diese Unterstellung haltlos ist. Davon abgesehen, dass es dem Opfer die alleinige Schuld gibt. Ich fragte nach einem Interview mit Johnson an. Seine Presseabteilung antwortete nicht.

Um fair zu sein, muss man jedoch eingestehen, dass Londons Bürgermeister – selbst ein Radfahrer – langsam Fortschritte erzielt. Im Jahr 2013 kündigte TfL den Safe Streets for London-Plan an, welcher die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 senken soll.
Ben Plowden vom TfL Oberflächenverkehr hierzu: „Im Jahr 2015 werden wir 145 Millionen Pfund für den Radverkehr investieren, etwa 18 Pfund je Kopf. Das entspricht in etwa den Pro-Kopf-Investitionen in den besten Radverkehrsstädten in Deutschland und ist knapp unter dem niederländischen Niveau. Die Summe entspricht in etwa zwei Prozent des TfL-Gesamtbudgets und ist nahezu proportional zum Zwei-Prozent-Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehr.“ Er fügt hinzu, dass die Ausgaben für den Radverkehr in den kommenden zehn Jahren insgesamt 913 Millionen Pfund betragen werden und damit das Dreifache des ursprünglich geplanten Niveaus.
§
Es ist noch nicht vollkommen klar, wie und wieso die Unfallrate von der Zahl der Radfahrer abhängt, aber ein „Safety in Numbers“-Effekt kann festgestellt werden: Die Sicherheit verbessert sich in einer Stadt, wenn die Gesamtzahl der Radfahrer steigt. Dieser Effekt konnte durch Studien in Dänemark, den Niederlande, 14 weiteren europäischen Ländern, Australien und in 68 Städten in Kalifornien bestätigt werden.
Es ist wahrscheinlich, dass die Begründung in beide Richtungen greift: sicherer Radverkehr schafft zusätzliche Radverkehrsnachfrage und mehr Radverkehr erzeugt wiederum mehr Sicherheit”, schreibt John Pucher, Professor für Stadtplanung an der Rutgers University, in seinem 2012 erschienenen Buch City Cycling, welches er zusammen mit Ralph Buehler verfasst hat. Das Verhalten der Autofahrer trägt vermutlich ebenfalls zu diesem Phänomen bei. In Städten wie Kopenhagen – wo vier von fünf Personen Zugang zu einem Fahrrad haben – sind die meisten Autofahrer ebenfalls Radfahrer. Sie sind es zudem gewohnt, den öffentlichen Raum mit Radfahrern zu teilen.
Es ist relativ schwierig, die Verkehrssicherheit von Städten direkt miteinander zu vergleichen, da die Erhebung der Daten oft unterschiedlich durchgeführt wird und man die Zahl der Verletzungen und Todesfälle immer in einen Kontext – sei es die Zahl der Wege, die zurückgelegte Fahrleistung oder die Zeit auf dem Fahrrad – setzen muss. Zudem wird die Zahl der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung sehr oft nicht vollständig erfasst.
Trotz aller Hindernisse, konnten Pucher und Buehler die folgende Kennziffer “Jährliche Todesopfer je 10.000 Radfahrer” ermitteln (2010):
- Kopenhagen 0,3
- Amsterdam 0,4
- Vancouver 0,9
- Toronto 1,3
- Portland 1,9
- Montréal 2,0
Jährliche Todesopfer je 100.000 Radfahrer (2009):
- Paris 8,2
- London 11,0
- New York 37,6
Solange man nicht mit halsbrecherischer Geschwindigkeit fährt, ist der Radverkehr an sich nicht gefährlich – es ist vielmehr das Umfeld, von dem die Gefahren ausgehen. Ian Roberts, Professor in der “Nutrition and Public Health Intervention Research Unit” der London School of Hygiene and Tropical Medicine, begann seine Karriere als Unfallarzt für Kinder. „Ich habe sehr viele Kinder gesehen, die von Autos angefahren wurden. Es ist wirklich schlimm.“ Er beschreibt diese Todesfälle als “kinetische Energiekrankheit“ – ein Bezug auf die Idee nicht zusammenpassender Massen in Bewegung. Wenn eine dieser Massen durch einen Metallkäfig geschützt ist, und die andere ist es nicht, dann ist relativ klar, wer stärker verletzt werden wird.
Ein Trend, über den Roberts lange gerätselt hat, war die langfristig rückläufige Zahl von getöteten Fußgängern, obwohl der Motorisierungsgrad weiter zunahm. „Menschen, die an mehr Verkehrssicherheit arbeiten, würden dies als Beispiel anführen, dass die Straßen sicherer werden. Aber ich war ein bisschen skeptisch, weil das Volumen an kinetischer Energie auf der Straße weiter zunahm.“ Eine alternative Hypothese lautet, dass in Industrieländern weniger Menschen zu Fuß gehen. Ein Effekt, den er während einer Forschungsarbeit in Neuseeland feststellen konnte. „Über die Jahre wurde es immer deutlicher, dass die Menschen immer weniger laufen und mit dem Fahrrad fahren als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.“, so Roberts. „Die Welt wurde nicht sicherer, sondern sogar gefährlicher und die Menschen reagierten mit ihren Füßen und gingen der wachsenden Gefahr eben aus dem Weg.“
Im Nordamerika der siebziger Jahre wollten Radfahrer – oder zumindest die lokalen Interessensvertretungen, welche für sich in Anspruch nahmen, die Radfahrer zu vertreten – nicht mehr aus dem Weg gehen. Das sogenannte „vehicular cycling“ entstand, eine Philosophie, welche die Verkehrspolitik sowohl in Nordamerika wie auch in Großbritannien nachhaltig geprägt hat. Erdacht vom kalifornischen Wirtschaftsingenieur und Fahrradaktivist John Forester, motiviert „vehicular cycling“ den Radfahrer dazu, auf der Straße im Mischverkehr zu fahren. Auf seiner Webseite schreibt Forester: „Vehicular cycling, so genannt, weil man wie ein normaler Fahrzeugführer unter Beachtung der minimalen Verkehrsregeln fährt, ist schneller und macht mehr Freude, sodass man dafür sogar den nervigen anderen Verkehr in Kauf nimmt.“
„In Kalifornien der 1970er Jahre haben sich viele sportliche Radfahrer zu Tourengruppen zusammengeschlossen, um gemeinsam schnell auf der Straße zu fahren“, erklärt mir Anne Lusk, Wissenschaftlerin an der Harvard School of Public Health. Damals haben diese Gruppen gefürchtet, dass die Übernahme von Radwegen nach niederländischem Vorbild ihren Zugang zur „richtigen“ Straße einschränken würde. „Zu dieser Zeit wurden Wege immer stärker von Joggern, Fußgängern, Inlineskatern und Kinderwagenschubsern genutzt“, sodass Radfahraktivisten sehr stark gegen den Bau von Radwegen kämpften.
Die Philosophie des auf der Straße Radelns wurde in die US-Regeln für die Anlage von Straßen aufgenommen und hat über Jahrzehnte den Bau von baulich vom Rest der Straße getrennten Radwegen verhindert und Radfahrer in den Straßenverkehr gezwungen.
„In Nordamerika hat sich dieses Prinzip wirklich festgesetzt“, erklärt mit Meghan Winters, Assistenzprofessorin an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Simon Fraser University, Kanada. Auf die Frage, ob die Philosophie des vehicular cycling sich auf Beweise stützte, antwortete sie mit Nein. „Es hat sich festgesetzt und wurde sehr breit für sehr, sehr viele Jahre akzeptiert“, fügt sie hinzu. Foresters Regeln umfassen unter anderem, wie man sich als Radfahrer einem Kraftfahrzeug möglichst ähnlich verhält. Das beinhaltet zum Beispiel nicht in der Türzone zu fahren, der Bereich neben einem parkenden Fahrzeug, in dem eine sich öffnende Tür einen Radfahrer gefährdet. Diese Regeln waren sehr sinnvoll, sagt Lusk, weil sie den Menschen beibrachten, wie man sich zu verhalten hat, wenn man gemeinsam mit Autos auf der Straße fährt. Aber sie unterstützt keinesfalls Foresters Ansicht, dass keinerlei Radfahrstreifen auf der Straße markiert sein sollen, keine Radwege gebaut oder Radverkehrs-spezifische Verkehrsschilder aufgestellt werden sollen.

Lusk und andere Wissenschaftler, welche die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen von Radfahrern wie Frauen, Kinder, älteren Menschen und Eltern, welche ihre Kinder auf dem Fahrrad mitnehmen, untersucht haben, machen darauf aufmerksam, dass viele dieser Fahrradfahrer nicht genauso selbstbewusst auftreten wie beispielsweise ein junger Mann mit einer sportlichen Fahrweise auf einem Tourenrad. Alltagsradeln auf einer fahrradspezifischen Verkehrsinfrastruktur soll inklusiv sein und die Bedürfnisse von jungen und alten, männlichen und weiblichen Radfahrern erfüllen. Der Wunsch nach hoher Geschwindigkeit ist nicht bei allen Radfahrern gleichsam vorhanden. Genauso wenig wie sich alle Radfahrer im starken, motorisierten Verkehr wohlfühlen.
Es ist genau diese Erkenntnis, dass Radfahrer in allen Formen und Farben auftreten und unterschiedliche Bedürfnisse haben, die in den vergangenen Jahrzehnten den Bau von Infrastruktur und die Politik in Dänemark und den Niederlanden geprägt haben. Tom Godefrooij von der Dutch Cycling Embassy schreibt:
Der Radverkehr ist als Verkehrsmodus zu wichtig, um ihn alleine den draufgängerischen, behelmten Radkriegern mit den auffallenden Jacken zu überlassen. Rad fahren ist nicht nur für eine bestimmte Elite gedacht, sondern für alle.
§
Am Amsterdamer Flughafen Schiphol beobachte ich einen Mitarbeiter, der seinen Kollegen auf dem Gepäckträger seines Fahrrads zum nächsten Flugzeug bringt. Ein weiteres Beispiel, wie tief das Fahrrad in der niederländischen Kultur verwurzelt ist.
Das Fahrrad ist mit Abstand die beste und schnellste Möglichkeit sich in Amsterdam zu bewegen, erzählt mir der Lokaljournalist Bennie Mols. Eine neue Gefahrenquelle, über die er sich beschwert, sind die Rad fahrenden Touristen, die nicht wissen wo und wie man richtig Fahrrad fährt. Seine Beschwerde nehme ich mit einem schlechten Gewissen zur Kenntnis.
Ich lerne schnell (aber leider zu spät), dass das Handzeichen für “Stopp” im dichten Radverkehr Amsterdams von essenzieller Bedeutung ist. Als ich einmal bremse, um mich zu orientieren und dabei das spezielle Handzeichen nicht mache, verursache ich beinahe eine Massenkarambolage. Das Rudel Fahrräder hinter mir kommt kreischend zum Stehen, eine Frau schreit mir mehrmals „ernsthaft?“ entgegen, als sie auf die Rasenfläche neben dem Radweg ausweichen muss. Mit dem Wunsch mich vor Scham in Luft aufzulösen, schreibe ich daraufhin die entsprechenden Handzeichen verlegen in meinen Reiseführer. Ein Fehler, den ich nie mehr machen werde.

Amsterdam und Kopenhagen waren nicht immer die fahrradfreundlichen Städte, die sie heute sind. In den Niederlanden fiel, als nach dem Zweiten Weltkrieg das Vermögen wuchs, der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen von 85 Prozent in den fünfziger Jahren auf etwa 20 Prozent in den frühen siebziger Jahren. Als die Zahl der Radfahrer zurückging und die Zahl der Autos entsprechend wuchs, stieg der Unmut über die wachsende Zahl von Fußgängern und Radfahrern, die im Straßenverkehr umkamen.
Ein Journalist, dessen Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, startete die „Stop Kindermoord“-Bewegung. Auf der Straße kam es zu weit verbreiteten Protesten.
Die dänische Verkehrspolitik erreichte ihren Wendepunkt in den siebziger und achtziger Jahren, als das Land sich von den Pkw-freundlichen Städtebauprinzipien verabschiedete und mehr Wert auf Verkehrsberuhigung und Infrastruktur für Fahrradfahrer legte. Als “Stop Kindermoord” in den Niederlanden gegründet wurde, entstand eine ähnliche Bewegung in Dänemark. Damals regte sich öffentlicher Widerstand gegen den Plan, eine Autobahn durch die malerische Seenlandschaft um Kopenhagen zu bauen. Es kam zu zahlreichen Massendemonstrationen. Es war zu jener Zeit, in der die Protestierenden damit begannen, getöteten Radfahrern mit weißen auf die Straße gemalten Kreuzen zu gedenken.

Während die anderen Industrienationen in den achtziger Jahren und danach so weitermachten wie bisher und der Straßenbau vor allem die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs im Blick hatte, kam es zu einer dramatischen Veränderung in Nordeuropa. Anstatt dass sich Kinder und Fahrradfahrer an den motorisierten Verkehr anzupassen hatten, hatte sich dieser an die Kinder und Radfahrer anzupassen. Dieser Mentalitätswechsel wurde durch den starken öffentlichen Protest gefordert und gefördert. Nordeuropas Wandel hin zu einer sichereren und bequemeren Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger war ein ungeplantes Experiment mit unsicherem Ausgang für mit vielen Unbekannten wie zum Beispiel die Kfz-Steuer, das Klima, die Topografie, politische Widerstände und die Automobilindustrie und die dortigen Arbeitsplätze.

In Städten, welche auch heutzutage sehr stark auf den motorisierten Verkehr fixiert sind, haben die begrenzte Bereitstellung passender Verkehrswege für Radfahrer und die Standardannahme, dass die breite Masse sich schon der Idee des vehicular cycling unterwerfen wird, in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer konstant sehr niedrigen Anzahl (meist männlicher) Radfahrer geführt.
“Es gibt dramatische Unterschiede in Sachen Radverkehrsanteil und Radverkehrssicherheit zwischen den beiden Gegenden [Nordeuropa und Nordamerika]“, so Meghan Winters. „Ich denke, es ist klar, welche der beiden Strategien effektiver ist, wenn große Teile der Bevölkerung Fahrrad fahren und Rad fahren sicher gestaltet werden soll…Es ist letztlich ein großes globales Experiment und ich glaube, dass Nordamerika nun durchaus kommen könnte.“ Vielleicht. Aber es ist bis dahin noch ein weiter Weg.
§
Es ist Sommer 2013 und der Verkehr in Toronto ist ein reines Chaos. Die Stadt steckt mitten in der Erneuerung von Straßen und Asphaltoberflächen. Der Verkehr quält sich auf der Bay Street nahe des Rathauses Stoßstange an Stoßstange in Richtung Süden. Es gibt nur wenige markierte Radfahrstreifen und nur einen vom restlichen Verkehr getrennten Radweg (abgesehen von den reinen Freizeitrouten, welche beispielsweise um den See führen). Taxis wechseln ständig die Spur und fahren zeitweise sehr nahe am Randstein. Dort wo die Radfahrer fahren. Es ist eine sehr feindliche Umgebung für den Radverkehr und ich spüre als Radfahrer nicht viel Toleranz vonseiten der Autofahrer.
Einer der Radler, mit dem ich in einem meiner Spontaninterviews spreche, sagt mir, dass er sich mehr Sorgen um die Fußgänger denn die Autofahrer mache. Eine weitere Gefahrenquelle in Toronto ist die Straßenbahn. Die Schienen, in welche man sehr einfach mit dem Reifen gerät, kosten wirklich Nerven. Toronto ist mir eigentlich nicht unbekannt – ich habe für über zehn Jahre hier gelebt – aber auf dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren war für mich wirklich kein Vergnügen.
In Vancouver hingegen scheint es ein Umdenken zu geben. Ich entdecke eine wachsende Zahl von Radfahrstreifen, Radwegen und Fahrradboxen an Kreuzungen, welche Radfahrern an Ampeln eine sichere Warteposition vor dem Autoverkehr ermöglichen.
Obwohl das Radfahren zu Freizeitzwecken an Orten wie dem Stanley Park seit Jahrzehnten möglich ist, ist es das Fahrrad als „normales“ Verkehrsmittel, welches mittlerweile im Fokus des Stadtrats und des Bürgermeisters Gregor Robertson, welcher ebenfalls zur Arbeit radelt, steht.
Einige der neuen Radwege fühlen sich sehr sicher an und sind sehr einfach zu nutzen. Aber es gibt immer noch Orte, an denen der Radweg abrupt an sehr gefährlichen Stellen endet, wie beispielsweise an einer Kreuzung, an welcher der Radweg ins Nichts verschwindet und inmitten des Kreuzungsbereichs zwischen zwei Fahrstreifen wieder auftaucht. Hingegen fühlt sich das Fahrrad fahren auf einem komplett vom restlichen Verkehr getrennten Radweg entlang des Dunsmuir und auf dem Viadukt richtig befreiend an. Vielleicht fordere ich mein Glück ein wenig heraus, als ich an einem Freitag den 13. mit dem Fahrrad durch Vancouver fahre, aber überall dort, wo Radwege markiert und der Verkehr beruhigt ist, fühle ich mich relativ sicher.
Die wissenschaftliche Betrachtung des städtischen Radverkehrs ist etwas ungeordnet, wenn nicht gar chaotisch, aber die Untersuchungen von abgetrennten Radwegen in Kombination mit Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu verringern), häufen sich. Ein Paper aus dem Jahr 2009, welches die Ergebnisse aus 23 Studien aus der ganzen Welt untersucht hat, kommt zu dem Ergebnis, dass „für den Radverkehr gebaute fahrradgerechte Infrastrukturen Stürze und Verletzungen bei Radfahrern reduzieren”. Neuere Untersuchungen in Vancouver und Toronto 3 durch eine Zusammenarbeit von 14 Forschern, darunter Winters, fanden heraus, „dass an zwei sich kreuzenden Wohnstraßen das normale Kreuzungsdesign sicherer sei als Kreisverkehre, und auf der freien Strecke Radwege entlang von Hauptverkehrsstraßen und die Verlagerung des Radverkehrs aus den Wohnstraßen sicherer sei, als wenn keine Radverkehrsinfrastruktur vorhanden sei.“ Viele weitere Untersuchungen werden noch von der „Canadian Cycling in Cities“-Forschungsgruppe folgen.

Montréal ist die fahrradfreundlichste kanadische Stadt, die ich besucht habe. Auch wenn keine Radfahrstreifen abmarkiert sind, sind Autofahrer im Allgemeinen sehr gelassen und stehen Radfahrern den benötigten Platz zu. Obwohl Montréal eindeutig hügeliger als Amsterdam oder Kopenhagen ist, scheint die wellenförmige Topografie für die Montréaler kein Hindernis zu sein.
Der Name der Stadt Montréal leitet sich vom Mont Royal (französisch: „königlicher Berg“) ab und bezieht sich auf den steilen – auch wenn nicht wirklich gebirgigen – Hügel und Park nahe des Stadtzentrums. Auf dem Plateau, einen anstrengenden Aufstieg vom Zentrum entfernt, befindet sich einer der Stadtteile mit dem stärksten Radverkehrsaufkommen. Der älteste Radweg der Stadt entlang der Rue de Brébeuf befindet sich dort, welcher die gesamte Insel (Île de Montréal) erschließt. Während der morgendlichen Hauptverkehrszeit sehe ich einen steten Strom von Fahrrädern auf dem Boulevard de Maisonneuve, einen von mehreren bi-direktionalen, vollständig getrennten Radwegen mit speziellen Fahrradampeln. Fahrräder dürfen auch in den Parkanlagen Montréals fahren, deren Wanderwege sowohl in der Freizeit als auch für die Fahrt zur Arbeit sehr gerne genutzt werden.
Es war in Montréal, die einzige nordamerikanische Stadt, die bereits in den achtziger Jahren spezielle Infrastruktur für den Radverkehr errichtet hat, in der Anne Lusk und ihre Kollegen die Sicherheit von Radverkehr auf spezieller Radverkehrsinfrastruktur mit der von Radverkehr auf der Straße untersucht hat. 4 Sie fanden heraus, dass spezielle Radwege niedrigere Unfall- und Verletzungszahlen (oder zumindest keine höheren) als auf der Straße haben, und konnten einen ähnlichen Trend für die USA feststellen. Die Forschung von Winters und ihren Kollegen unterstützt die Theorie, dass spezielle Radverkehrsinfrastruktur, welche die Interaktionen zwischen Radfahrern und dem motorisierten Verkehr reduziert, die Verletzungswahrscheinlichkeit um bis zu 50 Prozent senken kann.
§
Wie können wir also unsere Städte sicherer für den Radverkehr machen? Bereits heute existieren solche Städte sowie die entsprechenden Richtlinien und politischen Überzeugungen, von denen andere lernen können. In Orgeon ist Portlands „Gesetz zum Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer“ zum Beispiel auf Basis europäischer Verkehrssicherheitskonzepte entstanden, erklärt mir der Anwalt Ray Thomas, Partner bei Swanson, Thomas, Coon and Newton, eine Kanzlei, die sich auf Verkehrsrecht – insbesondere mit Fahrradbezug – spezialisiert hat. In Kopenhagen treffe ich bei einem meiner vielen Spontaninterviews auf einen jungen amerikanischen Studenten – Mike Milan aus Greenville, South Carolina – der in Kopenhagen Architektur studiert. “Wie ich in meinem Stadtgestaltungskurs gelernt habe, hat Kopenhagen versucht, die Stadt auf ein menschliches Tempo zu verlangsamen und einen menschlichen Maßstab zu geben.“ Seine Gedanken kristallisieren die Verkehrsphilosophie der Stadt heraus und sind gleichermaßen auf Amsterdam anwendbar.
“Damit sich Menschen sicherer auf Fahrräder fühlen, soll nicht bedeuten, dass wir sie mit Warnwesten und reflektierenden Helmen ausstatten“, erklärt mir Jack Harris, Eigentümer von Londons Tally Ho! Cycle Tours. „Wir brauchen eine Infrastruktur, die es einem breiten Querschnitt der Gesellschaft erlaubt, auf ein Fahrrad zu steigen.“ Jene Orte, die ernsthaft an der Förderung des Radverkehrs als sicheren, offenen und angenehmen Verkehrsträger arbeiten, haben einige schwierige Entscheidungen zugunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmer, einschließlich der Radfahrer zu treffen, wenn es um die Vergabe von städtischem Raum geht.

Im Kopenhagener Rehabilitationszentrum, wo Ann-Dörthe Hass Jensen arbeitet, sagt mir der Physiotherapeut Daniel Thue Bech-Pedersen: “Das Hauptziel unserer Rehabilitation ist es, dass jede Person wieder aktiv sein kann.” Aktiv für die Arbeit, für die Freizeit und um sich selbstständig bewegen zu können. „Wenn man sich selber an sein Ziel bringen kann und gleichzeitig das Risiko eines weiteren Schlaganfalls oder was auch immer senken kann, dann ist eins plus ein gleich drei.“
Ann leidet an chronischen Schmerzen von ihrem Fuß, muss spezielle orthopädische Schuhe tragen und an einem Stock gehen. Wieder auf ein Fahrrad steigen zu können, macht also einen riesigen Unterschied für ihre Mobilität. Es gab ihr auch ihre Unabhängigkeit wieder. Mit ihrem Lasten-Dreirad kann sie ihre zweijährige Nichte mit auf Ausflüge nehmen. Etwas, das zu Fuß oder mit dem Bus unmöglich wäre. Auf die Frage, wie sie sich an dieser Stelle ihrer Rehabilitation fühlt, und was sie empfindet jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, antwortet sie selbstbewusst und ohne jedes Zögern: „Ich liebe es.“ Ihr Rad hat ihr viel mehr wiedergegeben, als die reine Möglichkeit von A nach B zu kommen. Wieder mobil sein zu können, bedeutet unabhängig zu sein. Aber vielmehr bedeutet es für sie, frei zu sein.
Die Recherchen für diesen Artikel wurden zum Teil mit dem Preisgeld eines Journalismusawards des Canadian Institutes of Health Research finanziert, den Lesley Evans Ogden erhalten hat.
- Astrid Ledgaard Holm, Charlotte Glümer, Finn Diderichsen (2012): Health Impact Assessment of increased cycling to place of work or education in Copenhagen; Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Section of Social Medicine, University of Copenhagen, CSS, Copenhagen, Denmark, Research Centre for Prevention and Health, Glostrup University Hospital, Glostrup, Denmark – http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e001135.long ↩
- Lars Bo Andersen, Peter Schnohr, Marianne Schroll, Hans Ole Hein (2000): All-Cause Mortality Associated With Physical Activity During Leisure Time, Work, Sports, and Cycling to Work; Arch Intern Med. 2000;160(11):1621-1628. doi:10.1001/archinte.160.11.1621. – http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=485349 ↩
- Harris MA, Reynolds CCO, Winters M, et al. Comparing the effects of infrastructure on bicycling injury at intersections and non-intersections using a case-crossover design. Injury Prevention. 2013 – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786647/ ↩
- Lusk AC, Furth PG, Morency P, Miranda-Moreno LF, Willett WC, Dennerlein JT. Risk of injury for bicycling on cycle tracks versus in the street. Injury Prevention. 2011;17(2):131–135. – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3064866/ ↩


















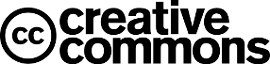
Es ist wirklich erschreckend, wie häufig die Gefahren, die von Bussen für Radfahrer ausgehen, auch von wohlgesinnten Verkehrsplanern ignoriert werden. Man denkt sich wohl: Sind ja beide ökologisch sinnvolle Verkehrsmittel, kann man also auf eine Spur legen, und schon ist die Katastrophe wie im Beitrag geschildert da.
Busse haben dieselben Totwinkel-Probleme wie Lkw, zudem halten sie alle naselang an und den rollenden Radler auf. Busse (samt Haltestellen) und Radfahrer gehören weiträumig getrennt, beide sollten nie spitzwinklig die Spur kreuzen müssen, ohne dass die Sichtverhältnisse klar sind.
Dann noch: Interessant am internationalen Vergleich könnte werden, wie die nachholende Entwicklung in Ländern wie England Deutschland “links” überholen könnte. Denn während dort vermehrt Radwege gebaut werden und es inzwischen auch Aktivismus für mehr separierte Infrastruktur entwickelt hat, hält sich in Deutschland die Vehicular-Cycling-Schule für Avantgarde (während sie tatsächlich den Mainstream bildet) und kämpft statt für bessere Radwege lieber gegen den Radweg an sich.
Wenn dann die letzte Radbenutzungspflicht aufgehoben ist, verliert Deutschlands den aktuell dritten Platz als Radnation hinter den Niederlanden und Dänemark – ironischerweise ausgerechnet in dem Moment, wo das Auto weltweit bergab fährt.
Hochinteressant, danke für den tollen Artikel!
Sehr schöner Bericht, Für mich bleibt Göttingen an erster stelle.
Super.