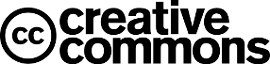Dies ist ein Gastartikel von Wilfried Brandt. Wenn auch Sie Interesse haben, hier einen Gastartikel zu veröffentlichen, dann schreiben Sie uns bitte.
Es begeistert geradezu, wie viele Menschen sich in ihren Kommunen mit vorbildlichen Zukunftsideen für eine Verbesserung der ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Nachhaltigkeit engagieren. Und viele Menschen wünschen sich zur Verbesserung ihrer eigenen Lebensumstände eine diskriminierungsfreie Mobilität sowie eine deutliche Reduzierung von Abgasen, Lärm und Unfallgefahren auf ihren alltäglichen Wegen und in ihrem Wohnumfeld.
Ein wesentlicher Beitrag zur Aufwertung des Wohnumfeldes sowie zur Verbesserung individueller Mobilitätsbedürfnisse besteht in der Stärkung der in den letzten Jahrzehnten stark vernachlässigten Nahmobilität. Deshalb fordert die EU in ihrem Weißbuch zur Verkehrspolitik einen Übergang von einer primär auf das Auto ausgerichteten persönlichen Mobilität in den Städten hin zu einer Mobilität, deren Grundlage zu Fuß gehen und Rad fahren bilden. Außerdem sollen bis zum Jahr 2050 in den Städten keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor fahren.
Der von der EU angestrebte Bewusstseinswandel ist jedoch bislang weder auf der Bundes-, der Länderebene noch in der kommunalen Planungspraxis angekommen, obwohl z. B. die Gruppe der Fußgänger nach dem motorisierten Individualverkehr die höchste Mobilitätsquote am Modal Split hält. Eine an das tatsächliche Mobilitätsaufkommen angepasste Mittelverwendung sucht man deshalb auf allen politischen Entscheidungsebenen vergeblich. Die zur Verfügung stehenden Mittel (einschl. direkter Subventionen an die Automobilindustrie) für verkehrsbezogene Bau- und Planungsleistungen werden weiterhin primär zur Förderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) eingesetzt, weshalb auf politischer Ebene keine Abkehr vom Autozentrismus erkennbar ist.
Der Proklamation der „Stadt der kurzen Wege“ folgen zumeist wenig konkrete Umsetzungsstrategien, weil regelmäßig Parkplätze für den MIV in „zumutbarer Entfernung“ gefordert werden bzw. das Beharren der Bauaufsichtsbehörden auf Einhaltung maximaler (Auto-) Stellplatzzahlen, viele Projekte zur Förderung der Nahmobilität schon im Ansatz zunichte macht. Chancengleichheit für alle Verkehrsteilnehmer wird es so in absehbarer Zeit nicht geben!
In vielen gewachsenen Stadtquartieren leben schon heute zahlreich ältere Menschen, deren Mobilitätsradius altersbedingt eingeschränkt ist, so dass sie auf ein gut ausgebautes und gut erreichbares Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen sind, wenn ihnen im Wohnumfeld aufgrund fortgeschrittener Konzentrationsprozesse im Einzelhandel keine Versorgungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Damit wurde dieser Bevölkerungsgruppe häufig auch eine Kommunikationsmöglichkeit entzogen, weil mit der Aufgabe von Einzelhandelsstandorten gastronomische Einrichtungen geschlossen wurden, da das Publikumsaufkommen damit insgesamt deutlich zurückging.
Die Novellierung der Landesbauordnungen führte zwar dazu, dass neugebaute Wohnungen heute barrierefrei errichtet und Wohnungen im Bestand –soweit technisch machbar- barrierearm umgebaut werden, aber bei fehlenden barrierefreien Beziehungen zwischen privaten und (halb-) öffentlichen Räumen wird die Mobilität und damit die gesellschaftliche Teilhabe bereits wieder eingeschränkt. Zudem ist zu erwarten, dass steigende Rohstoffpreise nicht nur das Betanken eines eigenen motorisierten Fahrzeugs sondern auch dessen Anschaffung und Unterhaltung für weite Teile der Bevölkerung unrealistisch erscheinen lassen. Gleichzeitig verliert das eigene Auto als Statussymbol bei immer mehr Menschen an Bedeutung.
Parallel zur demographischen Entwicklung müssen verstärkt Anstrengungen zur Klimaanpassung eingeleitet und umgesetzt werden, wobei auch hier der Nahmobilität eine zentrale Rolle zukommt. Die deutliche Reduzierung von Kurzstreckenfahrten mit dem eigenen Kraftfahrzeug (über 50% aller mit dem MIV zurückgelegten Fahrten in den Städten sind kürzer als 5 km) entlastet die Umwelt von erhöhten Abgasfrachten -insbesondere kalter Motoren- und Lärm. Gleichzeitig können unvermeidbare Verkehre sowie der Wirtschaftsverkehr störungsfrei abgewickelt werden.
Distanzen bis zu 6 km können mit dem Fahrrad kostengünstiger, schneller und umweltfreundlicher zurückgelegt werden als mit dem eigenen Kraftfahrzeug. Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings die Schaffung einer durchgehenden und intakten Infrastruktur für den Radverkehr. Dazu zählen auch geeignete Abstellmöglichkeiten (Diebstahl- und Witterungsschutz) sowie die Möglichkeit, elektrisch unterstützte Fahrräder (Pedelecs und S-Pedelecs) am Zielort oder im öffentlichen Raum mit elektrischer Energie versorgen zu können.
Im privaten Bereich müssen in Zukunft ebenfalls diebstahlsichere und vor Witterungseinflüssen geschützte Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Dazu haben viele Kommunen bereits Fahrradabstellsatzungen erlassen (z. B. Hilden, Münster), um die nach der Landesbauordnung notwendigen Fahrrad-Abstellanlagen in ausreichender Anzahl zu realisieren. Für Altbauquartiere bieten sich z. B. gemeinschaftlich zu nutzende Fahrradabstellanlagen an (z. B. in Dortmund, Hamburg, Würzburg). Häufig mangelt es aber am politischen Willen, das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel anzuerkennen. Noch viel zu häufig fürchten Politiker um Wählerstimmen, falls mit der Förderung des Fahrradverkehrs räumliche Einschränkungen für den MIV verbunden sein könnten. Schon ein Anfangsverdacht reicht häufig, um sinnvolle Nahmobilitätsprojekte auszuhebeln. Dies geschieht zumeist mit Rückendeckung einer autoaffinen Bau- und Planungsverwaltung.
Die Bereitstellung einer ausreichend und sicher ausgestatteten Infrastruktur sind wesentliche Bausteine zur Förderung der Nahmobilität, auf die mehr Menschen als heute angewiesen sein werden bzw. dies bewusst für sich in Anspruch nehmen. Diese Entwicklung entlastet nicht nur das Wohnumfeld und die alltäglich zurück zu legenden Wege von Abgasen, Lärm und Unfallgefahren sondern gleichzeitig die Umwelt an sich. Fußgänger und Radfahrer sind treue, weil standortbezogene Kunden und tragen damit zu einer Stärkung vorhandener Nahversorgungsbereiche bei. Die damit verbundenen Kommunikationsmöglichkeiten (man trifft sich und redet miteinander) fördert die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil /-viertel und fördert damit wiederum das Zusammengehörigkeitsgefühl als Basis für intakte Nachbarschaften.
Die in Politik und Verwaltung tradierten Mobilitätsmuster lassen sich zumeist nur mit viel Engagement und guten Planungsansätzen von außen aufbrechen, damit die Menschen in Zukunft wieder eine intakte Lebensumwelt mit hoher Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum vorfinden. Vielleicht endet dann die „Fahrt ins Grüne“ mit dem Fahrrad schon an der nächsten neu gestalteten Straßenecke auf den bequemen Stühlen des gerade wieder eröffneten Cafes!?