Der hohe Wohnungsdruck in München ist allseits bekannt. Seit Jahrzehnten übersteigt in der Region München die Nachfrage nach Wohnraum das zur Verfügung stehende Angebot. Die künftige Bevölkerungszunahme wird die Nachfrage nach Wohnraum weiter erhöhen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft ermittelte 2014 eine Zahl von 6.661 gebauten Wohnungen gegenüber einem jährlichen Bedarf von 11.438 Wohnungen in München. Somit werden nur 58 % des Bedarfs gedeckt.1
Diese Marktentwicklung bringt ein hohes Mietpreisniveau mit sich, das sich dynamisch weiterentwickelt. Die Erstbezugsmieten lagen 2016 bei einem neuen Höchstwert von 18,91 Euro/m², für Wiedervermietungen lag der Durchschnitt bei 15,72 Euro/m² und somit um 6,3 % höher als 2015. Hinzu kommt, dass der kleinste Wohnraum (20 – 40 m²) am teuersten ist. Von 2012 bis 2016 hat sich der Quadratmeter-Mietpreis bei diesen Wohnungen von 14,43 Euro auf 18,14 Euro erhöht.2 Insbesondere ökonomisch schwächeren Haushalten fällt es in einem derartigen Marktumfeld schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden.3
Bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums spielt auch der Verkehrsbereich insbesondere über die Erstellungskosten eines Stellplatzes eine Rolle. Entsprechend den geltenden Landesbauordnungen oder kommunaler Stellplatzsatzungen ist je Wohneinheit eine bestimmte Anzahl Stellplätze zu schaffen oder eine Stellplatzablöse an die Kommune zu entrichten. Für das typische Mietwohngebäude in Deutschland (12 Wohneinheiten à 73 m² Wohnfläche) belaufen sich die spezifischen Baukosten pro oberirdischen Stellplatz auf rund 250 €/m² Wohnfläche (Stand 2014).4 Das entspricht einem Anteil an den Gesamtbaukosten von durchschnittlich 9,3 %. Für einen Tiefgaragen-Stellplatz fallen im bundesweiten Durchschnitt etwa 18.200 € an. Dies entspricht spezifischen Baukosten von 650 €/m² Wohnfläche (11 – 19 % der Gesamtbaukosten). Für Metropolen wie Berlin, München u. a. werden spezifische Baukosten von 2.928 €/m² Wohnfläche und für Stellplätze in Tiefgaragen von rund 21.975 € pro Wohneinheit bzw. pro Stellplatz ermittelt.5
Die allgemeine Entwicklung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung sowie die Förderung innovativer Mobilitätsformen bspw. über die Schaffung integrierter Wohn- und Mobilitätsangebote kann die Beurteilung der Notwendigkeit zur Errichtung von Stellplätzen verändern. Dies kann einen Beitrag zur Senkung der Baukosten leisten und darüber hinaus auch sinkende Betriebskosten bedeuten. Vor allem dort, wo eine verminderte Stellplatzzahl den Verzicht auf die Errichtung einer Tiefgarage ermöglicht, sind Einsparmöglichkeiten vorhanden.6
Für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist neben der Senkung der Bauerstellungs- und Betriebskosten auch die Verfügbarkeit bebaubarer Grundstücke von entscheidender Bedeutung. So existierten am Münchner Bodenmarkt kaum noch freie Grundstücke, die zeitnah einer Bebauung zugeführt werden können. In München ist man daher einen kreativen Weg gegangen und nutzt eine bereits versiegelte Fläche doppelt.

Um den Wohnungsmangel in München zu dämpfen, wurde der weiterhin genutzte öffentliche Parkplatz am Dantebad mit einem Wohngebäude überbaut.
Im Rahmen des Wohnungsbausofortprogramms der Landeshauptstadt München realisierte die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG das Pilotprojekt im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg am Wintereingang des Dantebads entlang der Homerstraße. Auf dem knapp 4.200 m² großen Grundstück, das sich im Eigentum der Stadt befindet, wurden über dem öffentlichen Parkplatz 100 neue Wohnungen errichtet, davon 86 Einzimmerwohnungen (24 bis 31 Quadratmeter) und 14 Wohnungen mit 2,5 Zimmern (48,8 bis 54 Quadratmeter). Der Quadratmeterpreis liegt bei 9,40 Euro (kalt).

Nach der Überbauung stehen 105 von ursprünglich 111 Parkplätzen den Besuchern des benachbarten Freibades wieder zur Verfügung. Das Grundstück ist gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden. Der Stellplatzschlüssel wurde von 1 auf 0,2 Stellplätze pro Wohneinheit gesenkt.
Der 112,4 Meter lange und 15,75 Meter hohe Wohnkomplex steht auf einer Betonrahmenkonstruktion mit Stahlbetondecke. Die über die gesamte Gebäudelänge reichende Unterkonstruktion aus Ortbeton trägt das Gebäude und schirmt es gegenüber Brandlasten aus den darunter parkenden Pkws ab. Die darüberliegenden vier Stockwerke sind in Holzsystembauweise gefertigt. Die Bauzeit betrug dank des parallel ablaufenden abschnittsweisen Bauens und der Verwendung vorgefertigter Fertigelemente nur 180 Tage. Inklusive Planung, Ausschreibung, Baugenehmigung sowie Bauphase umfasste die gesamte Projektphase etwa ein Jahr. Projekte vergleichbarer Größe benötigen üblicherweise vier Jahre bis zur Fertigstellung.

Das schwellenfreie Gebäude besitzt insgesamt fünf Geschosse inklusive der Parkplätze, die nach der Fertigstellung zum Großteil wieder genutzt werden können. Es gibt Treppen sowie einen Aufzug. Vier Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Bei Bedarf können weitere Wohnungen so umgerüstet werden. Gemeinschaftsräume, Aufweitungen von Laubengängen und Freiflächen auf dem Dach bieten den Mieterinnen und Mietern Möglichkeiten des Aufenthalts außerhalb ihrer Wohnung und zur Begegnung. In den Obergeschossen am nördlichen Gebäudeende befinden sich Kellerersatzräume, im südlichen Gebäudeende Gemeinschaftsräume und eine Waschküche.

Die Baukosten des von Florian Nagler Architekten entworfenen Gebäudes betrugen zehn Millionen Euro. Weitere Bilder des Projekts können hier abgerufen werden.
- Henger, Ralph; Schier, Michael; Voigtländer, Michael (2015): Der künftige Bedarf an Wohnungen. Eine Analyse für Deutschland und alle 402 Kreise, IW policy paper, Nr. 24, Köln ↩
- Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2016): Wohnungsmarktbarometer 2016 ↩
- Landeshauptstadt München 2017, Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung. Fachstelle Armutsbekämpfung 2017: Münchner Armutsbericht 2017, S. 83f. ↩
- LK Argus GmbH Berlin 2015: Forschungsprojekt “Untersuchung von Stellplatzsatzungen und Empfehlungen für Kostensenkungen unter Beachtung moderner Mobilitätskonzepte”, S. 40ff. ↩
- ebd. ↩
- Bericht der Baukostensenkungskommission im Rahmen des Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), S. 88ff. ↩















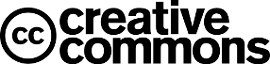
Auch im Umland ist dieser Druck spürbar und da klingt die Idee mit dem überbauten Parkplatz durchaus logisch.
So auch schon (vor laaaaaanger Zeit) beim Studentenwohnheim Weihenstephan IV in Freising geschehen.
Hallo,
ein wirklich spannender und interessanter Artikel.
Besonders bei den aktuellen Immobilienproblemen und den immer mehr werdenden Autos auf den Straßen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man damit in so mancher Stadt viele Vorteile hätte.
Gruß
Patrick der Staumelder
Und wieviele Erdgeschosswohnungen wurden für die Autos vernichtet?
Gar keine. Denn ohne die Überbauung hätte es vermutlich gar kein neues Wohngebäude gegeben, da die Fläche nicht zur Verfügung gestanden hätte. Zwar ist das Dante-Freibad über die Haltestelle Westfriedhof gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, aber das reicht nicht: man braucht auch einen politischen wie rechtlichen Rahmen, der eine Genehmigung ermöglicht. Das kann man ändern, dauert aber. Und dann gilt in diesem Fall insbesondere vor dem Hintergrund der Lage am Münchner Wohnungsmarkt für ökonomisch schwächere Haushalte: lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
Aldi könnte ja, neben den geplanten Wohnungen über dem Markt, gleich ihre riesigen Parkplätze mit überbauen… Mal davon abgesehen, dass die Wohnungen mit einer Vergrößerung der Marktfläche einhergehen und evtl. anderes Gewerbe damit verdrängen könnte.
Aber ich sehe es auch so, dass die Erdgeschosswohnungen in dem Fall nicht das Argument sind. Auch wenn ich gerade (leider) selbst in einer EG-Wohnung wohne und die Vorteile, gerade für Menschen mit körperlichen Einschränkungen (zB altersbedingt) kenne, ich würde gerne ein Geschoss höher ziehen und den Blick auf den Parkplatz vergessen. In dem Beispiel gibt es ja auch rollstuhlgerechte Wohnungen und Aufzüge…
Gestalterisch erinnert es mich an Nemausus 1&2 von Jean Nouvel, (ebenfalls) ein sozialer Wohnungsbau. Ein schöner ARTE Bericht!
Persönlich finde ich die P-0 – Norm in Schweden allerdings fast am reizvollsten, auch wenn sie nicht wirklich angewendet wird (OhBoy – Malmö), aber die Möglichkeit im Stadtzentrum keine Parkplätze einzuplanen zu müssen ist als Planer wirklich entlastend, gerade wenn viele Mieter gar kein Interesse an Stellplätzen haben.
Danke für den interessanten Beitrag!