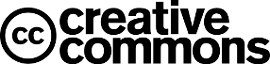Eine Antriebswende bringt nur dann einen Nutzen, wenn neu zugelassene Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzen und nicht ausschließlich den Gesamtfahrzeugbestand erhöhen. Für den Zeitraum 2016 – 10/2022 ist eine derartige Entwicklung nicht erkennbar.
Entwicklung des Bestands an Pkw mit Verbrennungsmotor und elektrischem Antrieb in Deutschland 2016 – 10/2022

Entwicklung des Bestands an Pkw mit Verbrennungsmotor und elektrischem Antrieb in Deutschland 2016 – 04/2022

Entwicklung der globalen Treibhausgas-Emissionen des Verkehrssektors in den Jahren 1970 – 2020

Dekarbonisierungsstrategien für die Seeschifffahrt

Grenzen integrierter Stadt- und Verkehrsplanung bei der Vermeidung von CO2-Emissionen im Verkehr (Scheiner und Holz-Rau 2019)

Umwelt
Eine Antriebswende bringt nur dann einen Nutzen, wenn neu zugelassene Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzen und nicht ausschließlich den Gesamtfahrzeugbestand erhöhen. Für den Zeitraum 2016 – 10/2021 ist eine derartige Entwicklung nicht erkennbar.
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs global und in allen Teilen der Welt stark gestiegen. Für die kommenden Jahrzehnte wird erwartet, dass das globale Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Emissionen weiter zunehmen. Die große Herausforderung lautet, die heutige Verkehrsmenge und deren Wachstum zu begrenzen, die verbleibenden Verkehre auf regenerative Energien umzustellen und somit den Verkehrssektor zu dekarbonisieren.
Etwa 3 % der globalen Treibhausgasemissionen werden von der internationalen Seeschifffahrt verursacht. Die Emissionen sollen in den kommenden Jahren erheblich zunehmen. Welche Strategien gibt es zur Begrenzung und anschließenden Reduktion der Treibhausgasemissionen hin zu einer dekarbonisierten Seeschifffahrt? Dieser Artikel gibt Einblick in technische und betriebliche Maßnahmen sowie einen Überblick über mögliche Energieoptionen.
Die Verkehrsentwicklung in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten durch ein starke Zunahme des Verkehrsaufkommens gekennzeichnet. Diese Entwicklung hat zum Teil ihre Ursache in Wechselwirkungen zwischen Raum und Verkehr, wird jedoch vornehmlich durch sozialen Fortschritt befördert. Die gesellschaftlichen und räumlichen Treiber können jedoch nicht auf kommunaler Ebene beeinflusst werden, sodass eine integrierte Standort- und Verkehrsplanung nicht mit der Vermeidung von CO2-Emissionen begründet werden sollte. Vielmehr sollte ihr Beitrag zu weiteren Zielen der Stadtentwicklung in den Vordergrund gestellt werden.
Der französische Staat hat die Gewährung von Staatsbeihilfen für die Fluggesellschaft Air France an Umweltauflagen geknüpft. Die Verbindlichkeit und mögliche Sanktionierung bei Nichterreichung der Ziele bleibt jedoch unklar. Die eingeforderte Überarbeitung des innerfranzösischen Liniennetzes zum Zwecke der Verlagerung auf die Bahn betrifft darüber hinaus nur drei von derzeit 57 Routen. Die Auflagen bedeuten somit mitnichten das Ende des innerfranzösischen Flugverkehrs wie es von Medien und in sozialen Netzwerken teilweise verbreitet wird.
Das prognostizierte Wachstum des Luftverkehrs und die damit zusammenhängenden absoluten Emissionen sollen vorrangig durch Technologie und "Nullemissionsflüge" reduziert werden. Durch den Einsatz neuer Flugzeugtypen oder anderer Energieformen wie bspw. Wasserstoff soll ein klimaneutrales Wachstum auf dem Weg zu einer emissionsfreien Zukunft im Luftverkehr erreicht werden. Dieser Artikel beleuchtet aus heutiger Perspektive die in den Jahren 1994 – 2013 am stärksten in Medien und Öffentlichkeit wahrgenommenen Technologiepfade. Es zeigt sich, dass viele technische Ankündigungen keine oder nur eine sehr begrenzte emissionsmindernde Wirkung entfalten konnten. Eine Vielzahl der Ankündigungen ist auch heute noch existent und Basis für Annahmen für das Jahr 2030 - 2050.