Dieser Artikel ist Teil der Serie Neue Möglichkeiten der LKW-Auflieger Verladung. Eine Übersicht über alle Artikel finden Sie hier.
In einer Studie der Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr e.V. aus dem Jahre 2005 wurde die technische, operative und wirtschaftliche Machbarkeit von Technologien für nicht kranbare Sattelanhänger im Kombinierten Verkehr Schiene/Straße im Hinterlandverkehr von Fähren untersucht. Dies geschah vor allem vor dem Hintergrund, dass 95% aller Auflieger in Europa nicht kranbar sind und es enormen Investitionen in Infrastruktur und Transportbehältnissen bedarf, um die Verlagerung von LKW-Verkehr auf die Schiene zu fördern.
Überprüft wurden die bereits in diesem Blog vorgestellten Technologien Modalohr, CargoSpeed, Flexiwaggon und CargoBeamer.
Die Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen darin, ob
- die Be- und Entladung des Sattelanhängers von der Anwesenheit des Zuges abhängig ist,
- die Umschlagtechnik fest installiert ist oder an Bord der Waggons mitgeführt wird,
- der Umschlag ein- oder beidseitig des Ladegleises erfolgt,
- der rollende Umschlag vorwärts oder rückwärts erfolgen kann oder muss,
- die Zugmaschine im Bedarfsfall mitgeführt werden kann oder stets dabei sein muss.
Zentrale Aspekte waren Transportzeit und -kosten des Sattelanhängers im Kombinierten Verkehr Schiene/Straße im Gegensatz zum reinen Straßentransport. Für die Transportkette wurde die Relation Südschweden – Mitteldeutschland repräsentativ betrachtet, die die Verladung auf einer Fähre via Lübeck mit einschließt.
Im Terminalablauf wurde berücksichtigt, dass die Sattelanhänger sowohl durch den Straßentransportunternehmer selbst als auch durch eine Terminal-Zugmaschine umgeschlagen werden können. Die Anbindung an den Seehafen wurde u.a. dadurch berücksichtigt, dass der dortige Umschlag ausschließlich mit dort bereits üblichen Terminal-Zugmaschinen (sog. Tugmaster) erfolgt. Es ergab sich ein Bedarf von 3 bis 5 Tugmastern im Inlandsterminal und bis zu drei Tugmastern mehr im Hafenterminal bei gleicher Umschlagleistung. Die vielfach aufgestellte Behauptung, dank der neuen Technologien könne bei allen Waggons eines Zuges parallel umgeschlagen werden, erscheint im Prinzip zwar technisch möglich, ist aber im realen Terminalbetrieb weder operativ noch wirtschaftlich darstellbar. Es ergab sich, dass die Umschlagleistung primär nicht von der gewählten Technologie abhängig ist, sondern vielmehr von der logistischen Organisation im Terminal, die allgemein nicht hinreichend berücksichtigt wird.
In der Betriebssimulation wurde ein Streckenring (Lübeck-Ruhrgebiet-Kassel-Hannover-Lübeck) untersucht. Bei eisenbahnbetrieblich günstiger Infrastruktur (u.a. ausreichend Überholgleise) könne demnach, da aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h aller Technologien im Mischbetrieb mitgehalten werden kann, eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 60 km/h am Tag und 75 km/h in der Nacht realisiert werden. Das Lichtraumprofil P/C 400 wird eingehalten, wobei es im unteren Profilbereich bei Ausführung mit niedriger Aufstandshöhe zu Überschreitungen kommen kann. Unter der Voraussetzung betriebsgünstiger Infrastruktur (unmittelbare kurze Anbindung des zuglangen Terminals an die Bahnstrecke) und der Bedienung mehrerer Zwischenhalte weisen Technologien wie CargoBeamer mit entkoppelten Umschlagverfahren (Entkoppelung der Zugbeladung vom Umschlag Sattelanhänger) zeitliche Vorteile für das Eisenbahnverkehrsunternehmen auf. Bezüglich der Transportzeit der Sattelanhänger über die Transportkette finden sich interessanterweise keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Technologien.
In der abschließenden Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde sowohl eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung als auch eine ringförmige Linienzugverbindung betrachtet. Die gemittelte Kostenbilanz weist zu einem Drittel Investitions- und Kapitalkosten aus, zwei Drittel sind Betriebskosten von Terminal und Zug. In der Sensitivitätsanalyse haben sich die Anzahl der Zuggarnituren, der Transportpreis und die Auslastung der Züge als die wichtigsten Einflussgrößen herausgestellt. Alle Technologien sind ohne öffentliche Förderung im Punkt-zu-Punkt-Verkehr ab einer Entfernung von 400 km und einer Auslastung von über 70 % wirtschaftlich, wenn sich ein Transportvolumen von mehr als 40.000 Sattelanhängern pro Jahr ergibt. Der Ringverkehr ist hingegen weniger profitabel.
Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass sich alle Technologien, soweit das aufgrund ihres recht unterschiedlichen Entwicklungstandes feststellbar ist, realisieren lassen. Die Technologien Modalohr (in Betrieb befindlich), CargoSpeed (Prototyp) und CargoBeamer (in der Erprobung) sind primär für größere Verkehrsströme und längere Relationen geeignet, während Flexiwaggon (Prototyp) für kleinere Umschlagplätze und Volumen Vorteile aufweist. Bezeichnend ist, dass alle Technologien nicht oder nur mit einigem infrastrukturellem Aufwand (außer bei Flexiwaggon) in die meisten bestehenden Terminals integrierbar sind. Die Technologien zeigen ihre Stärken als eigenständige Systeme, d.h. zumindest mit eigenen Terminals, womit dann die wohldurchdachte Umsetzung auf einem nachfragestarken Korridor entscheidend für den letztendlichen Erfolg wird. Im Detail ist zwingend zu beachten, dass technische Fragen wie die Sicherung des Sattelanhängers und operative Probleme wie die Entladung des Sattelanhängers im Schadensfall vorab zu klären sind. Schließlich nicht zu unterschätzen ist, dass eine zügige Zulassung der Technologien und der nicht kranbaren Sattelanhänger im Kombinierten Verkehr die Realisierung erst ermöglicht.
Dieser Artikel ist Teil der Serie Neue Möglichkeiten der LKW-Auflieger Verladung. Eine Übersicht über alle Artikel finden Sie hier.
















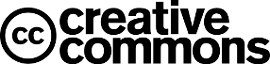
Es ist schade, dass in der Studie kein Liniennetz betrachtet wurde. Denn um nicht nur die großen Wirtschaftszentren zu verbinden, sondern um alle Regionen zu erschließen, benötigt man keine Punkt-Zu-Punkt-Verbindungen sondern ein Liniennetz mit ‘Umsteigebahnhöfen’ wie im Personenverkehr.
Bei solch einem Netz kommt es auf den autonomen Umschlagvorgang (also Trailer umschlagen ohne die Zugmaschine mitzuführen), die Umschlagzeiten und geringe Terminalkosten (die Terminals in den Regionen sind ja weniger genutzt) an. Der große Vorteil eines Liniennetzes ist aber, dass Verkehre gebündelt werden und die Züge überall gut ausgelastet verkehren.