Peter Calthorpe, Autor von “Urbanism in the Age of Climate Change”, ist Architekt und Stadtplaner und Direktor von Calthorpe Associates. Er ist einer der Gründer des Congress for New Urbanism (CNU) und hat neben verschiedenen Stadtentwicklungsprojekten auch Regionalpläne für Portland, Salt Lake City, Los Angeles und den Post-Hurrikan Southern Louisiana erstellt. Mittlerweile ist er vermehrt im Auftrag chinesischer Städte tätig. Im Jahr 1993 hat er in seinem Buch “The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream” das Konzept des Transit Oriented Development (TOD) in der Planungsprofession bekannt gemacht – siehe zu diesem Thema: [ÖPNV-orientierte Siedlungsentwicklung] Transit Oriented Development (TOD) vs. Transit Adjacent Development (TAD).
In seinem TED-Talk aus dem April 2017 stellte er sieben Prinzipien zum Bau bzw. zur Entwicklung “besserer Städte” vor. Sein Fokus liegt hierbei auf nordamerikanischen und chinesischen Städten.
Als besser bezeichnet Calthorpe kompaktere und nutzungsdurchmischtere Strukturen, da diese theoretisch mit einer geringeren Kfz-Fahrleistung verbunden sei. Dies brächte wiederum einen geringeren Flächenbedarf, weniger Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen sowie positive Gesundheitseffekte mit sich. Ebenfalls verweist er auf die ökonomischen Effekte und den Zusammenhang zwischen Wohn- und Mobilitätsausgaben. Höhere Kosten für Wohnen in einem urbanen Umfeld oder in Innenstadtbereichen werden durch niedrigere Mobilitätskosten (teilweise) kompensiert, günstige Bodenpreise und die damit verbundenen geringeren Wohnkosten in suburbanen / ländlichen Räumen durch höhere Mobilitätsausgaben zur Überbrückung der größeren Distanzen (vgl. Modelle von William Alonso zur Differenzierung von Bodenpreisen, Zentralität, Flächennutzungen und Landnutzungsintensitäten bzw. Richard Muth zum Trade-off von Pendel- zu Wohnkosten anhand der Entfernung zum Stadtzentrum).

Sieben Prinzipien für “bessere” Städte von Peter Calthorpe:
- Erhaltung der natürlichen Ökologie, der Agrarlandschaften und des Kulturerbes, um in einem urbanen Umfeld ein Gefühl der Identität zu schaffen.
- Stadtviertel mit gemischter Nutzung und gemischten Einkommensniveaus (keine ökonomische Segregation), um das Entstehen einseitig strukturierter und sozial isolierter Strukturen zu verhindern. Ebenfalls sollte eine ausreichende Zahl von frei zugänglichen und qualitativ hochwertigen Grün- und Freiflächen vorhanden sein.
- Den Fußgänger immer im Blick haben. Straßenräume wie Stadtviertel sollten sehr gut zu Fuß nutzbar sein, statt großer isolierter Strukturen sollte die menschliche Größe Maßstab sein. Hierzu gehört auch die Schaffung von Querungsmöglichkeiten, um bei Queren der Fahrbahn die Distanz so kurz wie möglich zu halten und durch eine Verengung der Fahrbahn eine Geschwindigkeitsdämpfung des Kfz-Verkehrs zu erzeugen. Eine aktive Erdgeschosszone (mit Geschäften o..) soll das Aktivitätslevel fördern, entlang wichtiger Achsen für den Fußverkehr sollen neben Aktivität auch Entspannen und Verweilen möglich sein.
- Priorisierung von Fahrradnetzen und autofreien Straßen, welche die Sicherheit und den Komfort des Fahrradfahrens in den Vordergrund stellen.
- Ein dichtes und feinmaschiges Straßen- und Wegenetz: Erhöhung der Dichte des Straßennetzes, Begrenzung der Blockgröße, Fokussierung auf Rad- und Fußverbindungen
- Entwicklung von qualitativ hochwertigem und erschwinglichem ÖPNV (Verweis auf Bus Rapid Transit). Haltestellen sollten gut zu Fuß erreichbar sein und Wohn-, Arbeits- und Dienstleistungsstandorte abdecken sowie schnelle Verbindungen zwischen diesen Bereichen ermöglichen.
- Anpassung von Dichte und Mischung der Bebauung an die maximale Beförderungskapazität öffentlicher Verkehrsmittel zur Spitzenstunde
Die rasante Urbanisierung, der demografische Wandel und der Infrastrukturbedarf stellen die Stadtentwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der Städte weltweit in Frage. Was sind die Bedürfnisse und Lösungen in wachstumsstarken Schwellenländern? Welche Rolle spielt die Stadterneuerung in reifen Märkten? Was ist mit Städten, die schrumpfen oder sich langsam erholen? Wie kommen Städte voran, um Lösungen mit langfristigem Nutzen zu realisieren? Interessierte können sich diesen etwa eine Stunde langen Mitschnitt dieser Podiumsdiskussion ansehen, in welcher die weltweit unterschiedlichen städtischen Herausforderungen skizziert und einige Gemeinsamkeiten aufgezeigt wurden, die den Städten bei den heutigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen helfen können. Zu Beginn (ab Minute 02:20) leitet Peter Calthorpe in das Thema ein und weist auf die verschiedenen Arten von Sprawl und auf die regionalen Verflechtungen hin, welche zersiedelte Strukturen als Folge haben können:















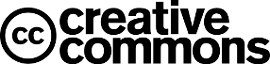
Hallo
Ich möchte einen 8 Punkt hinzufügen:
Der innerstädtische Verkehr sollte nicht isoliert betrachtet werden. Die Mobilitätsbedürfnisse der städtischen Bevölkerung enden nicht an der Stadtgrenze. Wenn man außerhalb der Stadt zum Auto gezungen wird, dann wird der Druck , das Auto in der Stadt zu benutzen und zu parken auch größer. Die Bedeutung des Freizeitverkehrs wird oft unterschätzt.